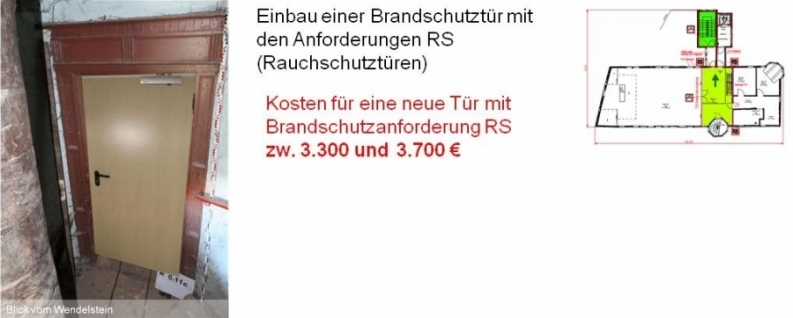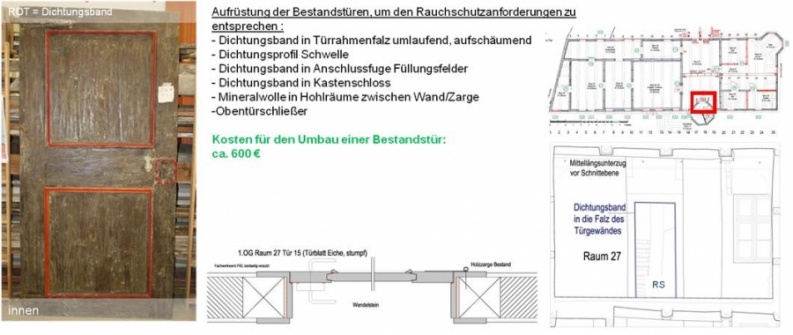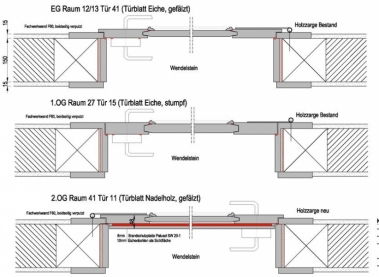4. Leistung der integrierten Planung zum Erhalt der historischen Bausubstanz-Ergebnisse der energetischen Ressourcen schonenden Ertüchtigung zum Brandschutz
4.1. Brandschutztechnische Ertüchtigung der bauzeitlichen Innenwände in der Diele im 1. Obergeschoss (Raum 27)
Beim Entfernen der jüngeren Putzschichten konnten
Fassungen aus der Erbauungszeit freigelegt
werden. Die beiden bauzeitlichen Bundwände in
der Diele im 1. Obergeschoss mit den ebenfalls
erhaltenen bauzeitlichen Blendrahmen sollten auf
Grund ihrer wertvollen Fassungsreste aus restauratorischer
Sicht in der Planung fassungssichtig
belassen werden.
Zur Kompensation der Abweichungen von den Forderungen der Landesbauordnung seitens des Brandschutzes konnte nach intensiven Gesprächen und Abwägungsfragen für die Decken, Wände und Fußböden eine "Heiße Bemessung von Holzbauteilen" durchgeführt werden.
Die Bemessung der Abbrandrate von Stützen mit einem Querschnitt von 28/22 cm in einer Bundwand bei zweiseitiger Beanspruchung und dem damit verbundenen Nachweis des Grenzzustandes der Tragfähigkeit erbrachte eine reelle Feuerwiderstandsdauer von 120 Minuten (1).
Zur Kompensation der Abweichungen von den Forderungen der Landesbauordnung seitens des Brandschutzes konnte nach intensiven Gesprächen und Abwägungsfragen für die Decken, Wände und Fußböden eine "Heiße Bemessung von Holzbauteilen" durchgeführt werden.
Die Bemessung der Abbrandrate von Stützen mit einem Querschnitt von 28/22 cm in einer Bundwand bei zweiseitiger Beanspruchung und dem damit verbundenen Nachweis des Grenzzustandes der Tragfähigkeit erbrachte eine reelle Feuerwiderstandsdauer von 120 Minuten (1).
Die Stützen in der historischen Bundwand aus Eiche besitzen
Querschnitte von 16/16. Somit konnten
Forderungen seitens des Brandschutzes für den
historisch wertvollen Bau hinsichtlich der Feuerwiderstandsdauer
auf 30 min reduziert werden (2).
Dieser Nachweis - bei gleichzeitigem Einbau der
Brandmeldeanlage (3) als
Kompensationsmaßnahme
- ermöglichte hier den Erhalt und die Freilegung
der historischen Fassungen der bauzeitlichen
Fachwerkwände (4).
Abschließend erfolgte der Anstrich der Gefache mit einer Kalkkaseinfarbe. Die Gefache wurden mit einem Altweiß gestrichen, die Fachwerkkonstruktion mit einem hellen Grau. Ein drei Zentimeter breiter Begleiter wurde umlaufend in die Gefachfläche gezogen.
Abschließend erfolgte der Anstrich der Gefache mit einer Kalkkaseinfarbe. Die Gefache wurden mit einem Altweiß gestrichen, die Fachwerkkonstruktion mit einem hellen Grau. Ein drei Zentimeter breiter Begleiter wurde umlaufend in die Gefachfläche gezogen.
4.2. Brandschutztechnische Ertüchtigung der Türen im Wendelstein (Raum 11)
Die Türen im Wendelstein sollten zunächst als
Rauchschutztüren gemäß DIN EN 16034 ausgeführt
werden. Vorgesehen war jedoch der in situ
Erhalt der wertvollen historischer Türen, deren
Umrüstung zu Rauchschutztüren gem. DIN EN
16034 nicht vollumfänglich möglich war. Bei den
raumtrennenden Türen zwischen Diele und Wendelstein
handelt es sich um gestemmte Rahmenfüllungstüren
mit einer symmetrischen Teilung in
zwei Füllungsfelder. Sie sind mit einer eingeschobenen
Brettfüllung geschlossen.
Beidseitig rahmen
die Füllungsfelder aufgesetzte Füllungsleisten.
Langbänder sorgen für die Drehbewegung
der links angeschlagenen Türen und ein Kastenschloss
mit Drücker und Türschild gewährleistet
die Schließung. Während die beiden Türen der
Renaissance im Erdgeschoss und 1. Obergeschoss
aus 5 cm starker Eiche bestehen, wurde
die Rahmenfüllungstür im 2. Obergeschoss aus
Nadelholz lediglich 2-3 cm stark ausgebildet. Angeschlagen
sind die Türen in den Blendrahmen
und den Ständer des Fachwerks mit Stützkloben.
Der Rahmen und das Futter waren mit schmiedeeisernen Nägeln mit der Fachwerkkonstruktion befestigt. Ein oberes Bekrönungsgesims mit Zahnschnittfries bildet den oberen Abschluss. Um Kompensationsmaßnahmen für den Einbau der historischen Türen und gleichzeitig einen größtmöglichen Rauchschutz zu erzielen, wurde in umfangreichen Gesprächen intensiv zwischen dem Prüfingenieur, dem Brandschutzgutachter, der Projektleitung/ Bauforschung und den Planern gearbeitet. Ausgangspunkt der Überlegungen war, dass der Wendelstein nicht genutzt wird. Die Türen zum Wendelstein werden verschlossen bleiben und nur zu besonderen Anlässen (Besichtigungen, Reparaturen) geöffnet. Grundsätzliche Kompensationsmaßnahme zur Sicherheit bildete auch hier eine Brandfrüherkennung über eine Brandmeldeanlage nach DIN 14675 (5). Die beiden Eichentüren im Erd- und 1. Obergeschoss mit einfachem Falz und Holzfutterzargen des 16. Jahrhunderts sollten zunächst mit einem Obertürschließer, Dichtungsband im Türrahmenfalz, im Schwellbereich sowie der Anschlussfuge der Füllungsfelder einseitig und dem Kastenschloss ausgeführt werden. Der Zwischenraum zwischen Türständer und Zarge sollte mit Mineralwolle ausgestopft werden. Nach intensiven Gesprächen mit dem Prüfingenieur für Brandschutz konnte der Einbau der Dichtungsbänder im Füllungs- und Kastenschlossbereich und Obertürschließer entfallen. Lediglich der Einbau der nicht brennbaren Dämmstoffe zwischen Türständer und Zarge und die Aufdopplung der Nadelholztür im 2. Obergeschoss mit 2,5 cm starken Eichenbohlen auf der Innenseite des Wendelsteins bildeten die Ertüchtigung der historischen Substanz.

Abb. 9 Verlegung der Holzweichfaserdämmung im Dachraum auf 21 mm starke Bohlen der neu zu schließenden Deckenfelder
4.3. Brandschutztechnische (F30) Ertüchtigung der Decke über dem 2. Obergeschoss
Die Deckenfelder im historischen Bestand wurden
mit Eichenholzstaken, eingeschoben in eine seitliche
Aussparung der Deckenbalken, geschlossen.
Die Staken erhielten auf der Raumseite einen
zweilagigen insgesamt 4 cm starken Strohlehmputz
auf der Oberseite einen Langstroh-Lehmverstrich
(Lehmschlagdecke), teilweise 4-6 cm
stark. Ein 5 cm starker Gipsestrich bildet den oberen
Abschluss.
In dem Nachtrag zur Baugenehmigung vom 22.08.2013 wurde jegliche Nutzung des Dachgeschosses, auch als Abstellmöglichkeit, ausgeschlossen. Somit sind Verkehrslasten > 1 kN/m2 auszuschließen.
Im Prüfbericht Pb10/12 des Prüfingenieurs für Brandschutz wurde gefordert, die Decke gemäß DIN 4102/4 von oben aufzurüsten.
Die neu ausgesetzten Deckenfelder wurden mit stumpf gestoßenen Bohlen geschlossen. Die Bohlen wurden von unten mit einem 4 cm starken Strohlehmputz verputzt. Entsprechend dem Regeldetail (gemäß DIN 4102-4 Pkt. 5.2.5) wurden auf der Oberseite 21 mm starke gespundete Bretter
In dem Nachtrag zur Baugenehmigung vom 22.08.2013 wurde jegliche Nutzung des Dachgeschosses, auch als Abstellmöglichkeit, ausgeschlossen. Somit sind Verkehrslasten > 1 kN/m2 auszuschließen.
Im Prüfbericht Pb10/12 des Prüfingenieurs für Brandschutz wurde gefordert, die Decke gemäß DIN 4102/4 von oben aufzurüsten.
Die neu ausgesetzten Deckenfelder wurden mit stumpf gestoßenen Bohlen geschlossen. Die Bohlen wurden von unten mit einem 4 cm starken Strohlehmputz verputzt. Entsprechend dem Regeldetail (gemäß DIN 4102-4 Pkt. 5.2.5) wurden auf der Oberseite 21 mm starke gespundete Bretter
verlegt. Anschlüsse und übergänge zu den
historischen Deckenfeldern wurden mit einem
Gipsestrich oder mit lehmgebundene Liaporkügelchen
angearbeitet. An den historischen Deckenfeldern
wurden lediglich Schäden innerhalb der
Gipsestrichfelder mit einem Gipsestrichmörtel repariert.
Auf den Einbau eines schwimmenden Estrichs von oben zum Schutz gegen eine Brandbeanspruchung konnte verzichtet werden, da eine obere Beplankung oder Schalung aus 19 mm dicken Spanplatten oder aus 21 mm dicken gespundeten Brettern eingebracht wurde und keine Verkehrslasten über 1,0 kN/m2 auftreten.
Abschließend erfolgte die Verlegung der Holzweichfaserdämmung zwischen den Sparrenfüßen und in den ertüchtigten Deckenabschnitten.
Auf den Einbau eines schwimmenden Estrichs von oben zum Schutz gegen eine Brandbeanspruchung konnte verzichtet werden, da eine obere Beplankung oder Schalung aus 19 mm dicken Spanplatten oder aus 21 mm dicken gespundeten Brettern eingebracht wurde und keine Verkehrslasten über 1,0 kN/m2 auftreten.
Abschließend erfolgte die Verlegung der Holzweichfaserdämmung zwischen den Sparrenfüßen und in den ertüchtigten Deckenabschnitten.
4.4. Einbau der Hängekonstruktion
2009 wurden infolge einer Notsicherungsmaßnahme
vier Hängewerke zur Unterstützung des
21 Meter langen Unterzuges im ehemaligen Rittersaal
eingebaut, der die gesamte Deckenlast -
Deckenbalken mit dazwischen liegenden Deckenfeldern
- trägt. Entsprechend den Anforderungen
des 2. Nachtrages der Baugenehmigung und der
Grundlage des Prüfberichtes (Prüfbericht 10/12
vom 14.05.2012, Prüfer Herr Schellknecht, Statik
Ingenieurbüro Hammer & Partner) mit der Einstufung
der Decken- und Wandbereiche F30, die
Festlegung der Nichtnutzung des brandlastenfreien
Dachgeschosses sowie dem Einbau einer
Brandmeldeüberwachung als Brandfrüherkennung
im Dachraum, konnte die Ertüchtigung der
gesamten Stahlkonstruktion hinsichtlich der
Brandschutzanforderungen optimiert werden.
Die vier mit offenen Profilen am Firstpunkt befestigten
Stahlseile umfassten den Unterzug auf der
Unterseite mit Flachstahllaschen. Diese Zugseile
und Stahllaschen konnten aufgrund der geringen
Querschnitte nicht mittels Anstrich brandschutztechnisch
ertüchtigt werden. Eine kastenförmige
Ummantelung der Stahllaschen mit Promatplatten,
an vier Stellen entlang des Unterzuges mit
den Malereien des 16. Jahrhunderts - Wappen
der Adelsfamilie und ihrer Familienmitglieder und
Verbündeten darstellend - wurde aus denkmalpflegerischen
Gründen abgelehnt.
Die brandschutztechnische Ertüchtigung der
sichtbaren Stahllaschen und Zugseile im Saal
erforderte zunächst das Lösen der 4 Zugstangen
und die Aufhängung der Konstruktion an
eine mittig durch den Unterzug geführte
Zugstange mit einer runden Stahlplatte als unteren
Abschluss.
Somit konnten die Flachstahllaschen entfernt
werden. Oberhalb des Unterzuges, im Dachraum,
wurde die zentral geführte Zugstange
an Stahlwinkel befestigt, an deren Oberseite
die vier Zugstangen der Konstruktion von
2009 gekontert wurden.